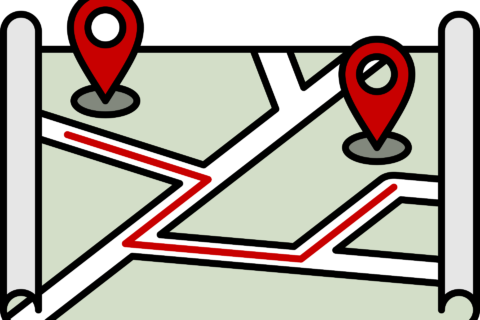Zur Wirksamkeit eines im Wege der Internetauktion (“eBay”) abgeschlossenen Kaufvertrages, bei dem ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht hat der Bundesgerichtshof erneut Stellung genommen. Anlass hierfür gabe dem Bundesgerichtshof eine abgebrochene Gebrauchtwagen-Auktion:

Der Verkäufer stellte einen gebrauchten VW Passat für zehn Tage zur Internetauktion bei eBay mit einem Startpreis von 1 € ein. Der Käufer nahm das Angebot wenige Minuten später an, wobei er ein Maximalgebot von 555, 55 € festlegte. Nach rund sieben Stunden brach der Beklagte die Auktion ab. Zu dieser Zeit war der Käufer der einzige Bieter. Auf dessen Nachfrage teilte der Verkäufer mit, dass er einen Käufer außerhalb der Auktion gefunden habe. Der Käufer nimmt den Verkäufer daraufhin auf Schadensersatz in Höhe von 5.249 € mit der Behauptung in Anspruch, dass das Fahrzeug 5.250 € wert gewesen sei.
Die Klage hatte vor dem erstinstanzlich hiermit befassten Landgericht Mühlhausen dem Grunde nach Erfolg, das Thüringer Oberlandesgericht hat die hiergegen gerichtete Berufung des Verkäufer zurückgewiesen. Und auch der Bundesgerichtshof wies nun die Revision des Verkäufer zurück:
Wie schon die Vorinstanzen bejahte der Bundesgerichtshof dem Grunde nach einen Anspruch des Käufers auf Schadensersatz statt der Leistung gemäß § 437 Nr. 3, § 280 Abs. 1, 3, § 281 Abs. 1 BGB.
Zwischen den Parteien ist ein Kaufvertrag über das Fahrzeug zustande gekommen. Der Verkäufer hat die Internetauktion ohne berechtigten Grund vorzeitig abgebrochen und war auch nicht zur Anfechtung seines Angebots wegen Irrtums nach §§ 119 ff. BGB berechtigt.
Der Schadensersatzanspruch scheitert auch nicht daran, dass der mit dem Verkäufer geschlossene Kaufvertrag als wucherähnliches Rechtsgeschäft wegen Sittenwidrigkeit nichtig wäre (§ 138 Abs. 1 BGB). Bei einer Internetauktion rechtfertigt ein grobes Missverhältnis zwischen dem Maximalgebot eines Bieters und dem (angenommenen) Wert des Versteigerungsobjekts nicht ohne Weiteres den Schluss auf eine verwerfliche Gesinnung des Bieters im Sinne von § 138 Abs. 1 BGB. Es bedarf vielmehr zusätzlicher – zu einem etwaigen Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung hinzutretender – Umstände, aus denen bei einem Vertragsschluss im Rahmen einer Internetauktion auf eine verwerfliche Gesinnung des Bieters geschlossen werden kann.
Solche Umstände wurden vorliegend aber gerade nicht festgestellt. Auch kann aus der Begrenzung des Gebots auf 555, 55 € nicht auf eine Sittenwidrigkeit geschlossen werden, da der Käufer nicht bereit gewesen sei, einen auch nur annähernd dem Marktpreis entsprechenden Preis zu bieten, abgesehen davon, dass sich für den Bundesgerichtshof nicht erschließt, weshalb ein (Höchst)Gebot unterhalb des Markpreises sittlich zu missbilligen sein soll. Gibt der Bieter ein Maximalgebot ab, ist er nicht gehalten, dieses am mutmaßlichen Marktwert auszurichten. Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, macht es gerade den Reiz einer Internetauktion aus, den Auktionsgegenstand zu einem “Schnäppchenpreis” zu erwerben, während umkehrt der Veräußerer die Chance wahrnimmt, durch den Mechanismus des Überbietens einen für ihn vorteilhaften Preis zu erzielen.
Der Verkäufer kann dem Käufer auch nicht den Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) entgegenhalten. Die Annahme eines Rechtsmissbrauchs erfordert eine sorgfältige und umfassende Prüfung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalles und muss auf besondere Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Einen solchen Fall verneint der Bundesgerichtshof vorliegend.
Die Auffassung des Oberlandesgerichts Koblenz, der Käufer sei nicht schutzwürdig, weil er von dem nicht zu erwartenden vorzeitigen Abbruch der Auktion profitieren wolle und nicht damit rechnen könne, den Kaufgegenstand bei Fortgang der Auktion tatsächlich zu dem geringen Gebot zu erwerben, ist im Schrifttum zu Recht auf Ablehnung gestoßen. Auch die Rechtsprechung der Instanzgerichte hat in ähnlichen Fallgestaltungen keine unzulässige Rechtsausübung durch den Käufer angenommen. Denn es ist der Verkäufer, der das Risiko eines für ihn ungünstigen Auktionsverlaufs durch die Wahl eines niedrigen Startpreises unterhalb des Marktwerts ohne Einrichtung eines Mindestpreises eingegangen ist. Zudem hat der Verkäufer in der hier gegebenen Fallgestaltung durch seinen freien Entschluss zum nicht gerechtfertigten Abbruch der Auktion die Ursache dafür gesetzt, dass sich das Risiko verwirklicht.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. November 2014 – VIII ZR 42/14