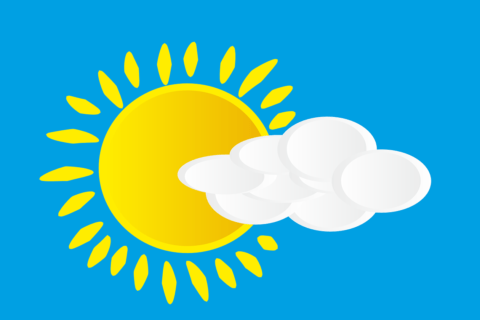Die Inpflichtnahme des Telekommunikationsdienstleisters findet seine Rechtfertigung grundsätzlich in § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO. Danach hat dieser daran mitzuwirken, den Ermittlungsbehörden die Maßnahmen nach § 100a StPO zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Der Umstand, dass die Verordnung über die technische und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation (TKÜV), die in § 110 Abs. 2 TKG ihre Grundlage findet, keine Regelungen zur Umsetzung der verfahrensgegenständlichen Anordnung enthält, macht diese selbst nicht unzulässig. § 100b Abs. 3 Satz 2 StPO bewirkt keine Einschränkung der nach § 100a StPO möglichen Maßnahmen, sondern regelt lediglich eine technische Vorhaltungsverpflichtung. Dies folgt bereits aus § 110 Abs. 1 Satz 6 TKG und § 3 Abs. 2 Satz 4 TKÜV, die jeweils ausdrücklich bestimmen, dass § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO unberührt bleibe. Dieses Verständnis entspricht auch dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers. Dieser erstreckte durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21.12 2007 die Mitwirkungspflicht des § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO auf solche Telekommunikationsdienstleister, die ein geschlossenes System betreiben und deshalb nicht geschäftsmäßig handeln. Dabei stellte er ausdrücklich klar, dass diese Dienstleister von den unverhältnismäßigen Kosten freigehalten werden sollen, die durch die Vorhaltungspflichten entstehen. Gleiches gilt bezüglich der Beschränkung des Kreises der durch die TKÜV Verpflichteten auf öffentliche Anbieter mit mehr als 10.000 Teilnehmern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in § 3 Abs. 2 Nr. 5 TKÜV.
Die Ermöglichung der Maßnahme ist indes von deren Durchführung zu trennen. Die durch § 100a Abs. 1 StPO gestattete Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation, mithin die Kenntnisnahme vom Inhalt der Mitteilungen, obliegt allein den Ermittlungsbehörden. Diese Aufgabenverteilung ist absolut. Entgegen der Ansicht des Generalbundesanwalts steht das für Mitarbeiter von Telekommunikationsdienstleistern bestehende Verbot, Gespräche mitzuhören, auch bei nicht standardisierten Maßnahmen nicht in Relation zu dem unabhängig davon geltenden Gebot des geringstmöglichen Eingriffs in das Fernmeldegeheimnis des einzelnen Nutzers.
§ 88 Abs. 3 Satz 1 TKG untersagt den Dienstanbietern, sich über das für die geschäftsmäßige Erbringung erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Dieses Verbot bleibt durch § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO unberührt. Hierdurch wird den Anbietern lediglich aufgegeben, den Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die Kommunikation zu gewähren.
Dabei ist der Zugang gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 TKÜV derart einzuräumen, dass der Verpflichtete (hier: die Beschwerdeführerin) der berechtigten Stelle (hier: den Ermittlungsbehörden) am Übergabepunkt eine vollständige Kopie der Telekommunikation bereitzustellen hat, die über seine Telekommunikationsanlage unter der zu überwachenden Kennung abgewickelt wird. Aus dem Umstand, dass die TKÜV keine detaillierte Regelung über die Umsetzung der verfahrensgegenständlichen Maßnahme enthält, folgt nicht, dass auch deren generelle Regelungen keine Geltung beanspruchen könnten. Diese bleiben über den Verweis in § 100b Abs. 3 Satz 2 StPO weiterhin anwendbar, da sie unabhängig vom Einzelfall Vorgaben zur Abwicklung machen (vgl. auch § 110 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) TKG)).
Die Inpflichtnahme des Telekommunikationsdienstleisters findet seine Rechtfertigung grundsätzlich in § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO. Danach hat dieser daran mitzuwirken, den Ermittlungsbehörden die Maßnahmen nach § 100a StPO zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Der Umstand, dass die Verordnung über die technische und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation (TKÜV), die in § 110 Abs. 2 TKG ihre Grundlage findet, keine Regelungen zur Umsetzung der verfahrensgegenständlichen Anordnung enthält, macht diese selbst nicht unzulässig. § 100b Abs. 3 Satz 2 StPO bewirkt keine Einschränkung der nach § 100a StPO möglichen Maßnahmen, sondern regelt lediglich eine technische Vorhaltungsverpflichtung. Dies folgt bereits aus § 110 Abs. 1 Satz 6 TKG und § 3 Abs. 2 Satz 4 TKÜV, die jeweils ausdrücklich bestimmen, dass § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO unberührt bleibe. Dieses Verständnis entspricht auch dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers. Dieser erstreckte durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21.12 2007 die Mitwirkungspflicht des § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO auf solche Telekommunikationsdienstleister, die ein geschlossenes System betreiben und deshalb nicht geschäftsmäßig handeln. Dabei stellte er ausdrücklich klar, dass diese Dienstleister von den unverhältnismäßigen Kosten freigehalten werden sollen, die durch die Vorhaltungspflichten entstehen. Gleiches gilt bezüglich der Beschränkung des Kreises der durch die TKÜV Verpflichteten auf öffentliche Anbieter mit mehr als 10.000 Teilnehmern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in § 3 Abs. 2 Nr. 5 TKÜV.
Die Ermöglichung der Maßnahme ist indes von deren Durchführung zu trennen. Die durch § 100a Abs. 1 StPO gestattete Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation, mithin die Kenntnisnahme vom Inhalt der Mitteilungen, obliegt allein den Ermittlungsbehörden. Diese Aufgabenverteilung ist absolut. Entgegen der Ansicht des Generalbundesanwalts steht das für Mitarbeiter von Telekommunikationsdienstleistern bestehende Verbot, Gespräche mitzuhören, auch bei nicht standardisierten Maßnahmen nicht in Relation zu dem unabhängig davon geltenden Gebot des geringstmöglichen Eingriffs in das Fernmeldegeheimnis des einzelnen Nutzers.
§ 88 Abs. 3 Satz 1 TKG untersagt den Dienstanbietern, sich über das für die geschäftsmäßige Erbringung erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Dieses Verbot bleibt durch § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO unberührt. Hierdurch wird den Anbietern lediglich aufgegeben, den Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die Kommunikation zu gewähren.
Dabei ist der Zugang gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 TKÜV derart einzuräumen, dass der Verpflichtete (hier: die Beschwerdeführerin) der berechtigten Stelle (hier: den Ermittlungsbehörden) am Übergabepunkt eine vollständige Kopie der Telekommunikation bereitzustellen hat, die über seine Telekommunikationsanlage unter der zu überwachenden Kennung abgewickelt wird. Aus dem Umstand, dass die TKÜV keine detaillierte Regelung über die Umsetzung der verfahrensgegenständlichen Maßnahme enthält, folgt nicht, dass auch deren generelle Regelungen keine Geltung beanspruchen könnten. Diese bleiben über den Verweis in § 100b Abs. 3 Satz 2 StPO weiterhin anwendbar, da sie unabhängig vom Einzelfall Vorgaben zur Abwicklung machen (vgl. auch § 110 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) TKG)).
Die Inpflichtnahme des Telekommunikationsdienstleisters findet seine Rechtfertigung grundsätzlich in § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO. Danach hat dieser daran mitzuwirken, den Ermittlungsbehörden die Maßnahmen nach § 100a StPO zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Der Umstand, dass die Verordnung über die technische und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation (TKÜV), die in § 110 Abs. 2 TKG ihre Grundlage findet, keine Regelungen zur Umsetzung der verfahrensgegenständlichen Anordnung enthält, macht diese selbst nicht unzulässig. § 100b Abs. 3 Satz 2 StPO bewirkt keine Einschränkung der nach § 100a StPO möglichen Maßnahmen, sondern regelt lediglich eine technische Vorhaltungsverpflichtung. Dies folgt bereits aus § 110 Abs. 1 Satz 6 TKG und § 3 Abs. 2 Satz 4 TKÜV, die jeweils ausdrücklich bestimmen, dass § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO unberührt bleibe. Dieses Verständnis entspricht auch dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers. Dieser erstreckte durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21.12 2007 die Mitwirkungspflicht des § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO auf solche Telekommunikationsdienstleister, die ein geschlossenes System betreiben und deshalb nicht geschäftsmäßig handeln. Dabei stellte er ausdrücklich klar, dass diese Dienstleister von den unverhältnismäßigen Kosten freigehalten werden sollen, die durch die Vorhaltungspflichten entstehen. Gleiches gilt bezüglich der Beschränkung des Kreises der durch die TKÜV Verpflichteten auf öffentliche Anbieter mit mehr als 10.000 Teilnehmern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in § 3 Abs. 2 Nr. 5 TKÜV.
Die Ermöglichung der Maßnahme ist indes von deren Durchführung zu trennen. Die durch § 100a Abs. 1 StPO gestattete Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation, mithin die Kenntnisnahme vom Inhalt der Mitteilungen, obliegt allein den Ermittlungsbehörden. Diese Aufgabenverteilung ist absolut. Entgegen der Ansicht des Generalbundesanwalts steht das für Mitarbeiter von Telekommunikationsdienstleistern bestehende Verbot, Gespräche mitzuhören, auch bei nicht standardisierten Maßnahmen nicht in Relation zu dem unabhängig davon geltenden Gebot des geringstmöglichen Eingriffs in das Fernmeldegeheimnis des einzelnen Nutzers.
§ 88 Abs. 3 Satz 1 TKG untersagt den Dienstanbietern, sich über das für die geschäftsmäßige Erbringung erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Dieses Verbot bleibt durch § 100b Abs. 3 Satz 1 StPO unberührt. Hierdurch wird den Anbietern lediglich aufgegeben, den Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die Kommunikation zu gewähren.
Dabei ist der Zugang gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 TKÜV derart einzuräumen, dass der Verpflichtete (hier: die Beschwerdeführerin) der berechtigten Stelle (hier: den Ermittlungsbehörden) am Übergabepunkt eine vollständige Kopie der Telekommunikation bereitzustellen hat, die über seine Telekommunikationsanlage unter der zu überwachenden Kennung abgewickelt wird. Aus dem Umstand, dass die TKÜV keine detaillierte Regelung über die Umsetzung der verfahrensgegenständlichen Maßnahme enthält, folgt nicht, dass auch deren generelle Regelungen keine Geltung beanspruchen könnten. Diese bleiben über den Verweis in § 100b Abs. 3 Satz 2 StPO weiterhin anwendbar, da sie unabhängig vom Einzelfall Vorgaben zur Abwicklung machen (vgl. auch § 110 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) TKG)).
Der Telekommunikationsdienstleister hat mithin die Kopie für die Ermittlungsbehörden auf der Ebene seiner geschäftsmäßigen Aufgabenerfüllung zu erstellen. Diese liegt beim Aufruf einer Internetseite durch einen Nutzer im Verbindungsaufbau zwischen dessen (dynamischer) IP-Adresse zu der im Ausland belegenen Internetseite, wobei in Deutschland (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1 TKÜV) durch den DNS-Server der Beschwerdeführerin allein die Übersetzung des Seitennamens in eine (statische) IP-Adresse vorgenommen wird, um die Weiterleitung zu ermöglichen. Da die Übersetzung schon allein anhand des Namens der Hauptseite möglich ist, kommt es für die Aufgabenerledigung durch die Betreiberin auf die letztlich vom Nutzer angesteuerte Sub-URL ebenso wenig an wie auf die von diesem genutzte Browserversion.
Bereits daraus folgt, dass eine auf diese Kriterien abstellende weitere Filterung den Ermittlungsbehörden obliegt, letztlich unabhängig davon, ob es sich dabei um “starke” oder “schwache” Inhaltsdaten oder lediglich nähere Umstände der Kommunikation handelt. Es kommt mithin nicht mehr darauf an, dass es für die Schwere eines Grundrechtseingriffs keinen Unterschied macht, ob dieser durch die Ermittlungsbehörden selbst oder in deren Auftrag durchgeführt wird.
Soweit grundsätzlich eine Anordnung in Betracht kommen könnte, mit der die Daten aller Verbindungsaufrufe zu der Hauptinternetseite den Ermittlungsbehörden zur Verfügung zu stellen sind, läge darin kein Minus zu der bislang durchgeführten Maßnahme, sondern ein Aliud. Hierfür bedürfte es indes eines ausdrücklichen Antrags.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 20. August 2015 – StB 7/15