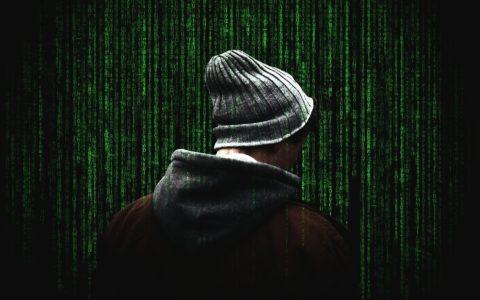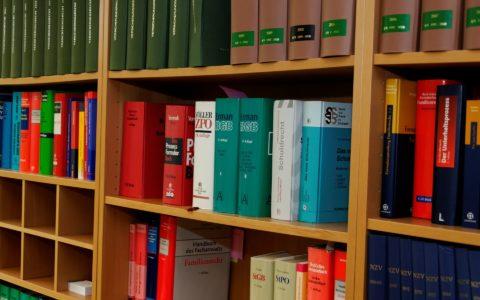Dadurch, dass die Betreiberin einer Suchmaschine (hier: Google) ihren Nutzern Hyperlinks auf Internetseiten anzeigt, auf denen ein bestimmtes Lichtbild veröffentlicht ist, verletzt sie ein unbenanntes ausschließliches Recht des Klägers zur öffentlichen Wiedergabe des Lichtbildes (§ 15 Abs. 2 UrhG).

Zwar ist die Bereitstellung eines Hyperlinks nur dann als öffentliche Wiedergabe anzusehen, wenn der Betreffende wusste oder hätte wissen müssen, dass der von ihm gesetzte Link Zugang zu einem unbefugt im Internet veröffentlichten Werk schafft, etwa weil er vom Urheberrechtsinhaber zuvor darauf hingewiesen wurde[1]. Ein solcher Hinweis kann aber durch vorgerichtliche Abmahnungen oder den Vortrag in der Klageschrift erfolgen.
Nach § 51 Satz 1 UrhG ist zwar die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zwecke des Zitats zulässig, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Die Suchmaschinenbetreiberin kann sich hierauf jedoch nicht berufen, wenn eine solche Rechtfertigung – wovon sich die Beklagte ohne eingehende rechtliche Prüfung überzeugen konnte und kann[2] – offensichtlich ausscheidet. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Bild als Beleg für eine Behauptung dienen soll, und dies nachgewiesermaßen eine Falschbehauptung ist oder das Bild hierzu ungeeignet ist, etwa weil das fragliche Detail auf dem Foto schon nicht hinreichend deutlich zu erkennen ist. Unter solchen Umständen ist nicht zweifelhaft, dass das Recht des Verfassers des Artikels auf Meinungsfreiheit hinter dem Recht des Klägers am geistigen Eigentum zurücktreten muss.
Entsprechendes gilt, soweit die Beklagte sich auf § 50 UrhG, d.h. auf die Berichterstattung über Tagesereignisse, beruft. Die insoweit gebotene Abwägung der betroffenen Grundrechte[3] geht aus den oben zu § 51 UrhG genannten Gründen zulasten der Beklagten aus. Aus den Entscheidungen des Landgerichts Hamburg vom 21.02.2023[4] und des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 04.08.2023[5] folgt nichts anderes, weil in dem von diesen Gerichten entschiedenen Fall eine Falschbehauptung nicht in Rede stand.
Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 4. Juli 2024 – 15 U 60/23
- vgl. BGH, Urteil vom 21.09.2017 – I ZR 11/16, GRUR 2018, 178 Rn. 55, 67[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 22.06.2021 – C-682/18 u.a., GRUR 2021, 1054 Rn. 116[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 30.04.2020 – I ZR 228/15, GRUR 2020, 859 Rn. 48[↩]
- LG Hamburg, Beschluss vom 21.02.2023 – 308 O 2/23[↩]
- OLG Hamburg, Beschluss vom 04.08.2023 – 5 W 3/23[↩]